Danny Günther arbeitet am Fraunhofer ISE als Teamleiter Wärmepumpen und Transformation Gebäudebestand. Er hat das Forschungsprojekt »Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand« betreut, das kürzlich zu Ende ging. Wir wollen von ihm wissen, welche Erkenntnisse das Forschungsprojekt zutage gefördert hat – neben den Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen und der damit verbundenen CO2-Vermeidung.
Wie effizient und klimafreundlich arbeiten Wärmepumpen im Bestandsgebäuden? Was hat euer Forschungsprojekt »Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand« ergeben?
Ein zentrales Projektergebnis ist: Wärmepumpen heizen auch in Bestandsgebäuden effizient und klimafreundlich und tragen so zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors bei. Wir haben vier Jahre lang detaillierte Messungen an bis zu 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern vorgenommen. In der Hauptauswerteperiode 2024 mit der größten Stichprobe haben wir Jahresarbeitszahlen von 2,6 bis 5,4 ermittelt. Luft/Wasser-Wärmepumpen erreichen im Durchschnitt eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,4, erdgekoppelte Anlagen kommen im Schnitt auf eine JAZ von 4,3. Das sind bessere Werte als in dem 2019 abgeschlossenen Projekt «WPsmart im Bestand«.
Die guten Werte haben zur Folge, dass Wärmepumpen deutlich klimafreundlicher sind als Erdgasheizungen: Die unter Berücksichtigung zeitvariabler Faktoren ermittelten Treibhausgasemissionen liegen 64 Prozent unter denen von fossil betriebenen Gaskesseln. Aufgrund des steigenden Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen in den kommenden Jahren – aktuell liegt er bereits bei mehr als der Hälfte – werden Wärmepumpen künftig noch klimafreundlicher.
Auf was sollten Planer und Installateure bei der Auslegung von Wärmepumpen achten?
Wir haben in dieser Studie die Messdaten nochmal detaillierter als in den vorherigen Projekten angeschaut und es steckt noch einiges an Potenzial in dieser Technologie. Wir kommen etwa zu dem Schluss, dass die meisten untersuchten Anlagen sehr großzügig dimensioniert sind. Die Mehrheit der Anlagen verfügt noch bei minus sieben Grad Celsius Außentemperatur über eine deutliche Leistungsreserve. Nur wenige der untersuchten Wärmepumpen konnten den Wärmebedarf an den kältesten Tagen nicht alleine decken. Warum die Wärmepumpen so großzügig dimensioniert sind, können wir nicht sagen, da uns von dem meisten Anlagen keine Planungsunterlagen dazu vorlagen. Aber wenn wir in die DIN EN 12831 zur Ermittlung der Heizlast schauen, sehen wir reine Rechenmethoden oder auf Verbrauschwerte basierende Ansätze. Dass die Wärmpumpen in Bezug auf den Verbrauch großzügig dimensioniert sind, hatte ich bereits erwähnt. Aber auch die Rechenmethoden berücksichtigen bspw. keine internen oder solaren Gewinne und führen zu einer Überschätzung der Heizlast. Egal wie vorgegangen wird, hier besteht noch Optimierungsbedarf! Was aber auf keinen Fall noch on top kommen sollte, sind Sicherheitszuschläge. Das heißt, es ist unnötig, dass bezogen auf die Heizlast eine noch höhere Leistungsklasse in der Geräteserie gewählt wird.
Wie können Wärmepumpenbetreiber und Fachleute von Euren Ergebnissen profitieren?
Auf Basis der analysierten Messdaten und den Rückmeldungen der Akteure haben wir im Abschlussbericht eine Prozessmatrix erstellt. Sie dokumentiert für die einzelnen Phasen Planung, Installation und Inbetriebnahme mögliche Qualitätsdefizite. Wie diese zu beheben sind, zeigen wir dort ebenfalls. Die Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt enthalten wertvolle Erkenntnisse für Planer, Installateure und Betreiber von Wärmepumpensystemen.

Kombination Wärmepumpe und Photovoltaik: Gibt es hierzu Erkenntnisse und Tipps aus dem Forschungsprojekt?
Ja. Die Kombination Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen haben wir ebenfalls untersucht, wenn auch mit einer zugegeben kleinen Stichprobe. Die Kombination erhöht den Eigenverbrauch des Solarstroms vom Dach. Ein Ansatz ist die Erhöhung der Solltemperaturen zur Raumheizung und Warmwasserbereitung, wenn die überschüssige Einspeisung des Solarstroms in das Netz einen Schwellwert übersteigt. Damit wird der überschüssige PV-Strom als Wärme im System zwischengespeichert. Die Wärmepumpe vermehrt mit Solarstrom zu betreiben, kann vorteilhaft sein: Solarstrom ist günstiger als der Strom aus dem Netz, auch verglichen mit Wärmepumpentarifen, die Wärmepumpen lassen sich klimafreundlicher betreiben und das Verteilnetz wird zu bestimmten Zeiten entlastet.
Die Ergebnisse der Untersuchung von sechs Wärmepumpen/Photovoltaik-Kombinationen zeigen: Die Gebäude ohne Batterie erreichen 25 bis 40 Prozent Autarkie und 22 bis 37 Prozent Eigenverbrauch. Mit Batterie erhöhen sich die Gebäude-Autarkie-Werte auf 32 bis 62 Prozent. Beim Gebäude-Eigenverbrauch steigen die Werte auf 40 bis 83 Prozent ebenfalls deutlich. Der größte Nutzen zeigt sich im Frühjahr und Herbst, wenn Solarstromertrag und Wärmebedarf gut zusammenpassen. Denn das ist auch wichtig zu erwähnen: in der Kernheizperiode gehen die solaren Beiträge in den Keller, da hilft auch eine Batterie kaum weiter.
Wer viel Solarstrom für die Wärmepumpe nutzt, senkt die Stromkosten spürbar. Die Stromkosten der untersuchten Wärmepumpen sanken ohne Batterie um acht bis 21 Prozent. Mit Batterie war die Einsparung noch höher, was aber durch die Kosten für die Batterie wieder deutlich geschmälert wurde. Mit Blick auf die vermutlich weiter fallenden Speicherkosten eine sicher gängige Option. Wer einen dynamischen Tarif nutzt, profitiert von dem erhöhten Eigenverbrauch übrigens weniger, da der Solarstrom auf dem Dach oft dann erzeugt wird, wenn die Börsenpreise – und damit der eigenen dynamische Stromtarif – niedrig sind. Gleichzeitig können Speicher zusätzlich sinnvoll im Zusammenspiel mit dynamischen Tarifen sein.
Auf Netzebene bleiben die Effekte des solaroptimiertem Betriebs begrenzt. Er reduziert die Photovoltaikrückspeisespitzen am Transformator auf der lokalen Niederspannungsebene nur um etwa zwei bis drei Prozent. Im Starklastfall ergibt sich eine Entlastung von rund sieben Prozent.
Hattet Ihr Kombispeicher und Hybridheizungen im Forschungsprojekt? Was muss man hier beachten?
Wir haben auch Anlagen analysiert, die einen Kombispeicher oder zusätzlich einen fossilen Heizkessel nutzen. Bei letzterem spricht man von Hybridheizungen oder bivalenten Heizsystemen. Bei einigen dieser Systeme war das Zusammenspiel nicht optimal umgesetzt.
In den acht untersuchten Anlagen mit Kombispeichern zeigte sich: Damit das System effizient arbeitet, müssen die Zonen für Raumheizung und Warmwasser im Speicher deutlich voneinander getrennt sein, etwa durch passende Anschlüsse, richtig platzierte Temperatursensoren und eine klare innere Aufteilung. So wird die Wärme an die richtige Stelle geliefert. Wenn die Anschlüsse ungünstig liegen, kann es passieren, dass eine Wärmeentnahme für die Raumheizung auf Trinkwarmwasser-Niveau erfolgt. Das senkt die Effizienz der gesamten Anlage.
Auch bei Anlagen mit zusätzlichem Heizkessel haben wir Verbesserungsmöglichkeiten gefunden. Hier kommt es vor allem darauf an, die Regelung so einzustellen, dass beide Systeme – Wärmepumpe und Kessel – im richtigen Verhältnis zusammenarbeiten und die geplante Betriebsweise tatsächlich erreicht wird. Wenn die Regelung der Anlage richtig eingestellt ist, kann die Wärmepumpe auch in Kombination mit einem Heizkessel den anvisierten größeren Teil der Wärme liefern. Sind die Einstellungen dagegen ungünstig gewählt, springt der fossile Kessel zu oft an – und übernimmt mehr Arbeit, als eigentlich nötig wäre. Das schmälert den Klimanutzen der Anlage.
Stichwort Lebensdauer: Ein häufiges Takten ist ungünstig für die Wärmepumpe. Was habt ihr dazu herausgefunden?
Die Lebenserwartung einer Wärmepumpe hängt stark davon ab, wie häufig sich der Verdichter an- und ausschaltet. Fachleute sprechen hier von Schalthäufigkeit oder Takten. Ist die Schalthäufigkeit hoch, belastet das die Bauteile des Verdichters sowie des Kältekreises und das reduziert die Lebensdauer. Die daraus resultierenden kurzen Betriebsphasen können auch die Effizienz mindern. Um das zu vermeiden, sind längere Betriebszeiten der Verdichter anzustreben.
Die Studie hat ergeben, dass es bei den Schalthäufigkeiten der Luft/Wasser-Wärmepumpen eine große Streuung gibt. Die Auswertung der Schalthäufigkeiten zeigt eine große Bandbreite von 540 bis 15.820 Verdichterstarts pro Jahr. 90 Prozent der Anlagen liegen unter 5.500 Starts, der Rest über diesem Wert. Ein Drittel liegt bei maximal 2.000 Verdichterstarts.
Die Hauptursachen für überdurchschnittliche Schalthäufigkeiten und damit kurze Betriebsphasen liegen meist in der Regelung der Anlagen und in dem Zusammenspiel mit dem Hydraulikkonzept und der Auslegung der Komponenten: Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Wärmepumpen und Heizkreise immer wieder unterschiedlich stark durchströmt werden. Weitere Gründe sind, dass die Wärmepumpe nicht immer ihren gesamten Leistungsbereich nutzt und manche Anlagen das ganze Jahr über für die Raumheizung freigegeben sind – auch wenn gar keine Wärme gebraucht wird. Hier lässt sich bei bereits bestehenden Anlagen noch einiges verbessern. Natürlich besteht auch ein Zusammenhang zur großzügigen Dimensionierung der Wärmepumpen.
Weiterführende Informationen
Alle Ergebnisse des Forschungsprojekts »Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand«, kurz »WP-QS im Bestand«, sind auf der Projektseite zu finden. Dort stehen auch alle unsere Partner, an die ein besonderes Dankeschön geht.

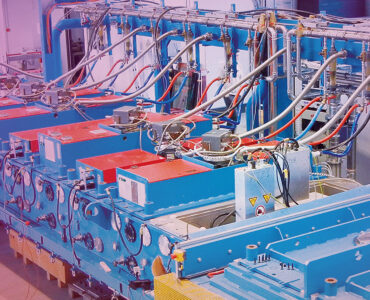
























Kommentieren