Grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel zur Energiewende – doch wie kann der Markthochlauf gelingen? Dr. Elias Frei, Bereichsleiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer ISE, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen von Wasserstoff als Energieträger. Erfahren Sie, warum Wasserstoff trotz aktueller Hürden unverzichtbar ist, welche Rolle blaue Optionen spielen und wie Deutschland eine führende Position in der europäischen Wasserstoffwirtschaft einnehmen kann.
Die Einführung eines neuen Energieträgers im industriellen und energiewirtschaftlichen Kontext basierte bisher stets auf mindestens einem der drei Vorteile: Verfügbarkeit, Energiedichte oder Ökonomie. In der chemischen Industrie Europas hat sich diese Transformation auf stofflicher Basis von Holz über Kohle, zu Öl und Gas vollzogen. Ersetzt man hierbei Holz durch Biomasse, hat man die aktuelle Auflistung der wichtigsten eingesetzten Energieträger im deutschen Energiesektor. Obwohl Wasserstoff derzeit keines dieser Kriterien erfüllt, wird er sich als fünfter Energieträger etablieren und fossile Alternativen schrittweise verdrängen. Wenn wir den Klimawandel aktiv bekämpfen und die europäischen Emissionsziele erreichen wollen, führt kein Weg an Wasserstoff vorbei.
Herausforderungen des zukünftigen Energiesystems
Um eine CO2-Konzentration von 600 ppm für unsere und kommende Generationen zu verhindern, wird Wasserstoff allein jedoch nicht genügen. Wir müssen uns auf emissionsfreie Primärenergiequellen fokussieren, die aktuell und absehbar technologisch ausgereift sind. Die uns dabei zur Verfügung stehenden, kostenkompetitiven Optionen sind dabei fast ausschließlich im Bereich der erneuerbaren Energien zu sehen. Allerdings wird der Bedarf an Strom in Deutschland durch die fortschreitende Elektrifizierung des Transportsektors, der Wärmeerzeugung und der industriellen Produktion bis zur Mitte des Jahrhunderts um den Faktor 2 bis 3 ansteigen. Das bedeutet, es gibt drei Probleme zu lösen:
- Technologieentwicklung zur Netzstabilisierung /-flexibilisierung und Energiespeicherung (Stichwort: Dunkelflaute)
- Verteilung großer Energiemengen innerhalb Deutschlands (Netzausbau: Nord-Süd-Gefälle, Sektorenkopplung: saisonal) und
- Energieimporte (wir haben nicht genug Elektronen, um alle Optionen zu realisieren)
Wasserstoff ist in allen drei Fällen Teil der Lösung:
- Wasserstoffspeicher in ausgesolten Salzkavernen, als Ergänzung zu Batteriegroßspeichern, dienen dem Erhalt der Grundlastfähigkeit über Wasserstoffkraftwerke und ermöglichen eine stabile Versorgung mit Wasserstoff.
- Das genehmigte Kernnetz – 9040 km für 19 Mrd., davon 40 % Neubau, 60 % umgewidmete Erdgasleitungen – als infrastrukturelle Voraussetzung zur flächendeckenden Versorgung mit Wasserstoff und kostengünstigen Verteilung großer Energiemengen in Deutschland (eine Wasserstoffpipeline mit 80 bar Druck und 48 Zoll Durchmesser und einer Übertragungskapazität von bis zu 16 Gigawatt kostet zwischen 0,88 und 4,4 Mio. Euro pro Kilometer, die Stromtrasse SuedLink mit einer Übertragungskapazität von 4 GW liegt bei ca. 14 Mio. Euro pro Kilometer – keine Diskussion, wir brauchen beides).
- Die Möglichkeit des Imports von grünem Wasserstoff, über den European Hydrogen-Backbone, oder in Form von grünen Wasserstoffderivaten im Rahmen von neuen internationalen Energiepartnerschaften.
Warum sollte diesmal der Markthochlauf funktionieren?
Das Ausrufen einer nationalen Wasserstoffstrategie und des europäischen Green Deals führte in den letzten fünf Jahren zu massiven Investitionen in Wasserstofftechnologien. Die Bundesregierung hat über große Förderprogramme Leitprojekte für den Wissens- und Technologieaufbau finanziert und internationale Energiepartnerschaften initiiert. Es wurden Algorithmen und Modelle für die Ermittlung globaler Wasserstoffpotenziale entwickelt, Lieferketten durchleuchtet und Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt. Parallel dazu wurden große Produktionskapazitäten für Elektrolyseure und Komponenten für Elektrolyseure beforscht und aufgebaut. Als Ergebnis entstanden, nicht nur in Deutschland mit staatlicher Unterstützung, die Zutaten für einen erfolgreichen Markthochlauf grüner stofflicher Energieträger wie Wasserstoff und seiner Derivate.
Allerdings wurde dabei zu einseitig auf der Angebotsseite stimuliert. Der Versuch, durch die gezielte Förderung großer Einzelmaßnahmen auf der Nachfrageseite einen Pull-Effekt zu erzeugen, ist bis heute nicht gelungen. Vereinfacht ausgedrückt: Ohne Markt keine Investitionen, ohne Investitionen in grüne Großprojekte keine Skalierungseffekte, ohne Skalierungseffekte keine Wirtschaftlichkeit. Vereinzelt wurden genehmigte Förderbescheide sogar wieder zurückgegeben oder verzögern sich stark, da sich trotz der Förderung kein wirtschaftliches Szenario im aktuellen Marktdesign darstellen ließ. Auch die Aktivitäten der Hintco GmbH als physischem Handelsvermittler für importierten Wasserstoff (Stichwort: H2Global Stiftung), führten aufgrund von mangelnder Planbarkeit noch nicht zu einem Markthochlauf: mit einjährigen Abnahmeverträgen lässt sich keine Investitionssicherheit auf der Verbraucherseite erzeugen.
Emissionsreduzierter Wasserstoff als Brückenlösung
Die grundlegende Motivation eines auf erneuerbaren Energien und Energieträgern aufgebauten Energiesystems ist die Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Auf dem Weg zu einer globalen Net-Zero-Gesellschaft werden langfristig grüne stoffliche Energieträger zweifellos eine wichtige Rolle einnehmen. Die konventionelle Erzeugung von »grauem« Wasserstoff verursacht jedoch aktuell einen erheblichen Emissionsrucksack. Im Gegensatz dazu können »blauer« Wasserstoff, der durch Dampfreformierung von Erdgas mit CO₂-Abtrennung und Speicherung entsteht, oder blaue Wasserstoffderivate zwischenzeitlich eine wichtige Rolle im Klimaschutz einnehmen. Mit bis zu 90 % weniger CO₂-Emissionen erfüllt er die Kriterien für low-carbon hydrogen der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie REDII. Dasselbe gilt für »türkisen« Wasserstoff, der hier aus Übersichtsgründen nicht näher betrachtet wird.
Wir sollten daher im Kontext des Hochlaufs nachhaltiger stofflicher Energieträger blaue Optionen, deren Erzeugung deutlich günstiger ist, ernsthaft prüfen. Durch kostenkompetitive Wasserstoffangebote kann eine Nachfrage und volkwirtschaftliche Wertschöpfung erzeugt werden, die nachhaltig und robust einen stabilen Markt in Deutschland und auch in Europa erzeugt. In diesem Sinne wäre blauer Wasserstoff der Steigbügelhalter, um großvolumige, grüne Investitionen planbar und attraktiver zu machen.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass wir Technologien zur CO2-Abscheidung und -speicherung, die in jedem globalen Net-Zero-Szenario erforderlich sind, fördern und weiterentwickeln. Eine Verschärfung des regulatorischen Rahmens würde später automatisch dazu führen, dass grüne Optionen blaue ersetzen. Es ist an der Zeit, pragmatische Entscheidungen, auch politische, in diese Richtung zu treffen. Denn schon in vier Jahren sollen die ersten Leitungen des neuen Wasserstoffkernnetzes fertiggestellt sein. Und China wartet mit seinen massiven Investitionen in nachhaltige Technologien und Wasserstoff aller Art nicht auf uns. Der Koalitionsvertrag stellt die richtigen Weichen. In Kombination mit einem gelebten Clean Industrial Deal kann Deutschland eine führende Rolle in der europäischen Wasserstoffwirtschaft einnehmen.
Dieser Meinungsbeitrag ist in einer kürzeren Version zuerst am 24. April 2025 im Handelsblatt erschienen: https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-so-laesst-sich-die-nachfrage-nach-gruenem-wasserstoff-anschieben/100118725.html
Titelbild: © iStock.com / peterschreiber.media


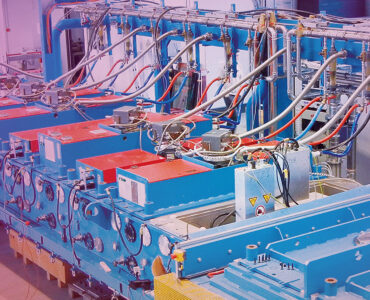























Kommentieren