Ein Interview mit Prof. Hans-Martin Henning, langjähriger Leiter des Fraunhofer ISE, zum Start in den Ruhestand nach über 35 Jahren Energieforschung.
Sie sind 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gekommen. Was hat Sie damals dazu bewogen?
Ganz konkret hat mich Prof. Joachim Luther, bei dem ich an der Universität Oldenburg promoviert hatte und der im Dezember 1993 als Institutsleiter ans Fraunhofer ISE wechselte, gefragt, ob ich mitkommen möchte. Er hielt besonders thermisch aktive Materialien, also z.B. Zeolithe und Latentmaterialien, und deren Anwendung für vielversprechende Forschungsthemen und dazu hatte ich schon gearbeitet. Zudem war es für mich natürlich eine tolle Perspektive, an das damals schon – zumindest in Deutschland – bedeutendste Institut für Solarforschung zu gehen.

An welchen weiteren Themen haben Sie am Fraunhofer ISE geforscht?
Etwa zehn Jahre lang war mein Schwerpunkt die Solarthermie. Ich habe viel dazu publiziert und war auch in den Forschungskooperationsprogrammen der Internationalen Energieagentur sehr aktiv, insbesondere zur solarthermischen Kühlung auf Basis von Sorptionstechnik. Als aber die Photovoltaik und damit der Solarstrom immer günstiger wurden, wurde zunehmend klar, dass solarthermisches Kühlen gegenüber dem solarelektrischen nicht wettbewerbsfähig sein wird. Das ergibt sich schon aus thermodynamischen Überlegungen, es wurde dann aber zusätzlich durch wirtschaftliche Tatsachen untermauert. Wir haben das Thema dann beendet und uns anderen Nutzungsmöglichkeiten von Sorptionsverfahren zugewandt. Aber das gehört zur Wissenschaft dazu: man probiert Dinge aus und verwirft sie auch teilweise wieder.
Sie haben viel über Gebäude geforscht. Warum hinkt der Gebäudesektor in Deutschland bei der Defossilisierung hinterher?
Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Bei Mietwohnungen gibt es oft ein Dilemma zwischen Kosten und Nutzen: Vermieter müssen investieren, profitieren jedoch nicht direkt von den Einsparungen – hier bedarf es komplexer Regelungen im Hinblick auf Aufteilungsfragen. Eigenheime werden häufig von älteren Menschen bewohnt, die nicht bereit sind, langfristige Investitionen zu tätigen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Fokus lange Zeit auf der baulichen Sanierung lag – wie etwa der Fassadendämmung oder dem Austausch von Fenstern. Zwar ist es wichtig, den Energiebedarf zu senken, doch solche Maßnahmen sind oft kostenintensiv und die Amortisation dauert lange. Jetzt verschiebt sich der Schwerpunkt der Investitionen in effiziente Anlagentechnik, während die energetische Sanierung der Gebäudehülle etwas in den Hintergrund tritt, insbesondere wenn es um sehr hohe Energiestandards in Bestandsgebäuden geht. Wärmepumpen spielen dabei eine entscheidende Rolle – eine Technologie, mit der wir uns am ISE schon lange intensiv beschäftigt haben. Insgesamt könnte die Politik durch zielgerichtetere Förderungen im Gebäudesektor eine schnellere Defossilisierung unterstützen. Wir brauchen eine sozial ausgerichtete Förderung, die besonders die unterstützt, die sich Investitionen nicht leisten können und bei der Mitnahmeeffekte möglichst vermieden werden.
Ab den 2000ern haben Sie sich dann intensiver mit systemischen Fragen befasst und das REMod-Modell zur Modellierung des deutschen Energiesystems entwickelt. Wie kam es dazu?
Wir haben uns damals am ISE einerseits sehr stark mit Photovoltaik, elektrischen Speichern und elektrischer Systemtechnik befasst. Auf der anderen Seite haben wir an Wärmetechniken, Solarthermie, Wärmepumpen und Gebäudeeffizienz gearbeitet. Strom- und Wärmesektor schienen aber recht wenig voneinander zu wissen. Es wurde dann zunehmend offensichtlicher, dass man die Sektoren zusammendenken muss, da immer deutlicher wurde, dass der Strom für die Wärmewende eine wichtige Rolle spielen wird. Wenn es dann nicht nur um ein einzelnes Gebäude, sondern die Transformation der gesamten Volkswirtschaft geht, bedarf es entsprechender Rechenwerkzeuge, um zu durchdringen, wie die Dinge voneinander abhängen. Es ergeben sich viele Fragen, zum Beispiel im Hinblick darauf, welche Technologien wo in welchem Umfang eingesetzt werden sollen: Welche Flexibilisierungsmöglichkeiten hat man? Welchen Speicherbedarf gibt es? Welche Speicherarten können wann und wo genutzt werden? Das waren Fragen, die nicht zu beantworten sind, wenn man nur einen Sektor anschaut. Dies war die wesentliche Motivation für die Entwicklung des REMod-Modells – mal abgesehen davon, dass ich immer sehr viel Freude an der modellbasierten Simulation und Optimierung hatte.
REMod wurde dann kontinuierlich weiterentwickelt. Was waren die wichtigsten Erweiterungen?
Anfangs hat REMod den Strom- und Wärmesektor mit Schwerpunkt auf Gebäuden detailliert abgebildet. Die Industrie war nur sehr pauschaliert über den summarischen Prozesswärmebedarf berücksichtigt. Mittlerweile haben wir das Modell erweitert, um eine differenzierte Darstellung sowohl der Industrie als auch des Verkehrssektors zu integrieren. Jetzt können wir detailliert die Kosten aller Einzeltechnologien und ihre Nutzung in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern berücksichtigen und nicht nur aggregierte Bedarfsgrößen. Zudem sind mittlerweile auch regionale Modellierungen möglich, und wir haben Studien erstellt, die unterschiedliche gesellschaftliche Verhaltensweisen bei der Transformation des Energiesystems berücksichtigen.
Studie »Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem«
Bundesländer im Transformationsprozess
Fraunhofer ISE (2024)

Mit REMod erstellte Studien zeigen unterschiedlich schnelle und kostenintensive Transformationspfade für das Ziel der Klimaneutralität 2045 auf. Kann Deutschland dieses Ziel noch erreichen?
Über alle Sektoren betrachtet ist Deutschland derzeit auf Kurs im Sinne der Ziele des Klimaschutzgesetzes. Seit 1990 haben wir unsere Treibhausgasemissionen nahezu halbiert. Doch nun ist eine erhebliche Beschleunigung der Transformation erforderlich, um die zweite Hälfte der Einsparungen in den nächsten 20 Jahren zu erreichen, und dies obwohl viele niedrig hängende Früchte bei der CO2-Einsparung abgeerntet sind. Einige Reduktionen resultierten auch aus Faktoren, die nicht mit Klimaschutz in Verbindung stehen, wie etwa die Wiedervereinigung und die damit verbundene Abwicklung von Teilen der DDR-Industrie oder wirtschaftlich schwache Phasen wie seit der Corona-Pandemie. Das Besondere an der deutschen Energiewende ist der starke Fokus auf erneuerbare Energien und der gleichzeitige Ausstieg aus der Kernenergie. Auch Technologien zur Dekarbonisierung fossiler Energien – also z.B. Erdgas in Verbindung mit Carbon Capture and Storage oder blauer Wasserstoff – spielen bislang keine Rolle. Es ist insofern schon sehr ambitioniert und kein leichter Weg, in 20 Jahren bei den Emissionen auf Netto-Null zu kommen, insbesondere, wenn wir die wesentliche Struktur unserer Industrie erhalten wollen.
Welche nächsten, konkreten Schritte sind dafür erforderlich?
Ein entscheidender Punkt ist die Elektrifizierung der Nachfrage-Sektoren. Im Gebäudesektor bedeutet das vor allem den Einsatz von Wärmepumpen, im Verkehrssektor die Förderung der Elektromobilität. Auch in der Industrie sollte, wo es möglich ist, die Stromnutzung – je nach Prozess-Temperatur mit Wärmepumpen oder direkt – vorangetrieben werden. Hier sind Investitionen auf verschiedenen Ebenen notwendig, sowohl von Hauseigentümern als auch von Fahrzeughaltern sowie bei Industrieunternehmen. Ich bin optimistisch, dass die Preise für Batterien so stark sinken werden, dass ein Elektroauto bald nicht mehr teurer sein wird als ein herkömmlicher Verbrenner. Der Investitionsbedarf liegt hier vor allem bei der Ladeinfrastruktur und den Stromnetzen. Im Wärmebereich stehen ebenfalls Investitionen in Wärmenetze an. Der nächste große Schritt ist dann die Nutzung von stofflichen Energieträgern, die wir vor allem in verschiedenen industriellen Prozessen benötigen werden. Aktuell ist Wasserstoff im Vergleich zu fossilen Energien noch merklich teurer. Hier müssen Forschung und Entwicklung Kostensenkungen bei Komponenten wie Elektrolyseuren und Brennstoffzellen erreichen, wie wir sie bereits bei Photovoltaik und Batterien gesehen haben und weiterhin sehen. Dies sind Themen, an denen auch das ISE intensiv arbeitet.
Die politische wie gesellschaftliche Energiedebatte erscheint zunehmend aufgeladen. Wie kann die Energieforschung zu mehr Lösungsorientierung beitragen?
Die zunehmende Politisierung und Ideologisierung und der oftmals konfrontative Politikstil stehen weniger mit der Energiewende im Zusammenhang, sondern darin spiegeln sich breiter angelegte gesellschaftliche Entwicklungen wider. Diese Themen sind meines Erachtens stark von einem neuen Kommunikationsstil geprägt, der sich vor allem in den sozialen Medien zeigt. Die Rolle der Wissenschaft sollte weiterhin darin bestehen, aufzuklären und Fakten zu präsentieren. Dabei ist es wichtig, selbstkritisch zu sein und eigene Sichtweisen zu hinterfragen. Ich war beispielsweise lange Zeit skeptisch, was die Dekarbonisierung fossiler Energien betrifft. Inzwischen halte ich es jedoch für notwendig, auch diesen Weg zu gehen, um klimaneutral zu werden. Ich denke hier insbesondere an Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, wobei der Kohlenstoff abgetrennt und entweder als CO2 deponiert oder als fester Kohlenstoff gewonnen wird und dann womöglich als Rohstoff verwendbar ist. Die Entwicklung dieser Technologien ist im Übrigen auch in engem Zusammenhang mit Negative Emission Technologies zu sehen – also Technologien, bei denen Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen wird.
Was ist der Mehrwert bei der Dekarbonisierung fossiler Energiequellen?
Trotz unserer Erfolge in Deutschland sind wir im globalen Kontext viel zu langsam unterwegs. Wir haben bislang nicht einmal den Trend hin zu einem Rückgang der Emissionen erreicht, geschweige denn den Kurs, der notwendig wäre, um die Ziele von 1,5 oder auch 2 Grad globaler Erwärmung zu erreichen. Klimaschutz muss international erfolgreich sein. In vielen Ländern gibt es aber nach wie vor kostengünstig förderbare fossile Energien in großer Menge zur Verfügung. Wenn wir diesen Akteuren ein Angebot machen können, ihre fossilen Energieträger weiter zu fördern und den Kohlenstoff abzutrennen, könnte dies ein Schritt in Richtung globaler Zusammenarbeit sein. Das erfordert von Ländern wie Deutschland die Bereitschaft, solche Energieträger zu nutzen. Für die Forschung bedeutet das, dass wir auch Technologien zur Kohlenstoffabtrennung entwickeln müssen. Es ist meines Erachtens wichtig, sich nicht nur auf »grünen« Wasserstoff zu konzentrieren, sondern übergangsweise auch »blauen« und »türkisen« Wasserstoff zu nutzen, womit auch der Einstieg in den Infrastrukturaufbau befördert wird. Meines Erachtens müssen wir uns solchen Optionen öffnen, um noch eine Chance auf eine einigermaßen verträgliche globale Erwärmung zu wahren.
Von 2020 bis 2025 waren Sie Vorsitzender des durch die Bundesregierung berufenen Expertenrats für Klimafragen, der sich mit eben jenen Fortschritten Deutschlands bei der Energiewende befasst. Wie lautet Ihre Bilanz?
Letztendlich müssen andere den Wert unserer Arbeit bewerten. Aber im Rückblick würde ich sagen, dass sich der Rat als wichtiges unabhängiges Gremium für die Begleitung der Umsetzung der Klimapolitik etablieren konnte. Und ich finde, dass Deutschland mit dem Klimaschutzgesetz einen guten Rahmen geschaffen hat, um den nationalen Klimaschutz kontinuierlich voran zu treiben und dazu gehört die regelmäßige Begutachtung. Es wurden Ziele festgelegt, auch für Sektoren und einzelne Etappen. Es gibt den jährlich wiederkehrenden Mechanismus der Berichterstattung zu den Sektoren und seit der letzten Novelle auch die Projektion. Ich halte es für sinnvoll und hilfreich, dass der Expertenrat regelmäßig unabhängig und kritisch prüft, bewertet und aufbereitet – sowohl für die Politik als auch für die Öffentlichkeit. So hat sich auch das Selbstverständnis des Rates etabliert, dass er bewusst mit Zurückhaltung agiert und nicht alles und jedes kommentiert, aber den Ministerien ein differenziertes Bild der Emissionsentwicklung und vermittelt und Programme und Maßnahmen bewertet. Wir haben auch viel positives Feedback von den unterschiedlichen demokratischen Parteien und Ministerien bekommen und an den vielen Nachfragen aus den Ministerien zu unseren Gutachten gemerkt, dass diese auch im Detail gelesen werden. Dagegen empfinde ich die immer wieder aufflammenden Diskussionen über die Reduktionsziele als überflüssig und unglücklich, da es bereits gesetzliche Vorgaben gibt. Wenn wir diese immer wieder in Frage stellen, verschwenden wir Zeit und Kraft und beschäftigen uns mit endlosen Zieldiskussionen, während es doch darum geht, die Umsetzung erfolgreich voranzutreiben.

Würde es der Energiewende mehr Akzeptanz verschaffen, wenn sie stärker als wirtschaftliches Erfolgsmodell für die deutsche Industrie würde? Stattdessen dominieren an vielen Stellen asiatische Player den Markt.
Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit hat meiner Meinung nach weniger mit der Energiewende zu tun, sondern vielmehr mit den Standortbedingungen in Deutschland und Europa. Zwar haben wir höhere Energiepreise, aber in vielen Standortstudien werden vor allem die aufwändige Bürokratie, die langen Genehmigungsverfahren und die Komplexität der Berichtspflichten beklagt. Außerdem müssen wir geopolitische Realitäten anerkennen. Es ist grundsätzlich richtig, an offenen Märkten festzuhalten, aber dies wird schwierig, wenn wesentliche Akteure auf der Welt sich nicht mehr daran halten, indem sie ihre Industrien stark subventionieren, Zölle erheben oder wettbewerbsverzerrende Rahmenbedingungen schaffen. Deutschland und Europa sollten daher eine aktivere Industriepolitik betreiben. Es gibt bereits Ansätze, aber sie gestalten sich in der Umsetzung zumeist schwierig, wie beim Net Zero Industry Act, der seit zwei Jahren diskutiert wird, ohne dass bislang konkrete Maßnahmen beschlossen wurden. Hier sind meines Erachtens zu viele nationale Interessen im Spiel, und Europa wird oft nicht als ein großer, gemeinsamer Heimatmarkt wahrgenommen, in dem die eigenen Produkte, die nachhaltiger hergestellt wurden, Vorteile erhalten sollten. Dennoch gibt es nach wie vor viele europäische Unternehmen, die global wettbewerbsfähig und erfolgreich sind – in der Energiebranche und darüber hinaus. Dies gilt es unbedingt zu halten und auszubauen – ein Anliegen, das gerade auch die Fraunhofer-Gesellschaft maßgeblich unterstützt. Was das Wissenschaftssystem und die Hochschulausbildung in Deutschland angeht, so sehe ich einen hohen Standard und alles in allem viele gute Mechanismen zur Förderung von Innovationen.
Welche Technologien und Innovationen werden in den nächsten Jahren besonders wichtig werden?
Über die Nutzung von Kohlenstoff aus fossilen Energieträgern hatten wir schon gesprochen. In diesem Bereich werden wir von fossilen zu verschiedenen, für unterschiedliche Verwendungsszenarien maßgeschneiderten Molekülen auf Basis von Wasserstoff kommen. Hier ist noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten und das Fraunhofer ISE ist sehr gut aufgestellt, einen nennenswerten Beitrag zu liefern. Des Weiteren werden wir bei den mobilen wie auch den stationären Batteriespeichern noch viele neue Entwicklungen sehen, insbesondere zu den heutigen Lithium-Ionen-Batterien alternative Zelldesigns und -chemien, wie beispielsweise Batterien mit festen Elektrolyten oder aber auch Natrium-Ionen-Batterien. Die mobilen Anwendungen sollten unbedingt ein Schwerpunkt der Industriepolitik sein, denn für die gesamte Automobilbranche ist der Batteriespeicher die zentrale Komponente. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat das erkannt und forscht intensiv an der Optimierung von Batterieproduktionsprozessen.

Auch im Bereich Wärmepumpen sind weitere Innovationen zu erwarten. Zunächst geht es vor allem um klimaschonende Kältemittel und die Ausweitung der Wärmepumpennutzung in neue Anwendungsfelder wie Prozesswärme, langfristig möglicherweise aber auch um neuartige Verfahren, wie die Elektrokalorik, die die traditionelle Verdichter-Technologie ergänzen könnten. In der Photovoltaik sehe ich noch großes Potenzial durch neue Zell- und Modularchitekturen, die die Stromgestehungskosten weiter senken können. Zudem werden wir weiterhin innovative Ansätze sehen, um Photovoltaik besser in unterschiedlichste Nutzanwendungen und die bebaute Umwelt zu integrieren – hier, im Bereich der Forschung zur integrierten PV hat sich das ISE eine führende Rolle erarbeitet.
Nun werden Sie nach 31 Jahren am Fraunhofer ISE in den Ruhestand gehen. Was werden Sie ganz besonders vermissen?
Es ist einfach unglaublich bereichernd, Teil eines Organismus zu sein, in dem mit so viel Herzblut, Engagement und Begeisterung an Themen gearbeitet wird, die für unsere Zukunft entscheidend sind. Erneuerbare Energien werden, wie alle relevanten Studien zeigen, die tragende Säule für die nachhaltige Gestaltung unserer Energieversorgung sein. Ich werde es sicher vermissen, Teil der Community zu sein, die daran arbeitet – sei es am ISE, bei Fraunhofer oder in der globalen Wissenschaftsgemeinschaft. Das war für mich immer inspirierend und hat mir die Energie gegeben, mich mit aller Kraft für Fortschritte in diesen Bereichen einzusetzen. So sehr ich mich darauf freue, künftig mehr Zeit für andere Dinge zu haben, wird mir dies sicher fehlen.
Prof. Dr. Hans-Martin Henning studierte an der Universität Oldenburg und ist promovierter Physiker. 1994 kam er als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, das er von Januar 2017 bis September 2025 in einer Doppelspitze mit Prof. Dr. Andreas Bett leitete. Prof. Henning ist Experte in den Bereichen Gebäudeenergietechnik und Energiesystemanalyse und Mitglied in zahlreichen Gremien und Beiräten. Von 2020 bis 2025 war er Mitglied und Vorsitzender im durch die Bundesregierung berufenen Expertenrat für Klimafragen.
Titelbild: © istock.com/FrankRamspott, Overlay: Fraunhofer ISE
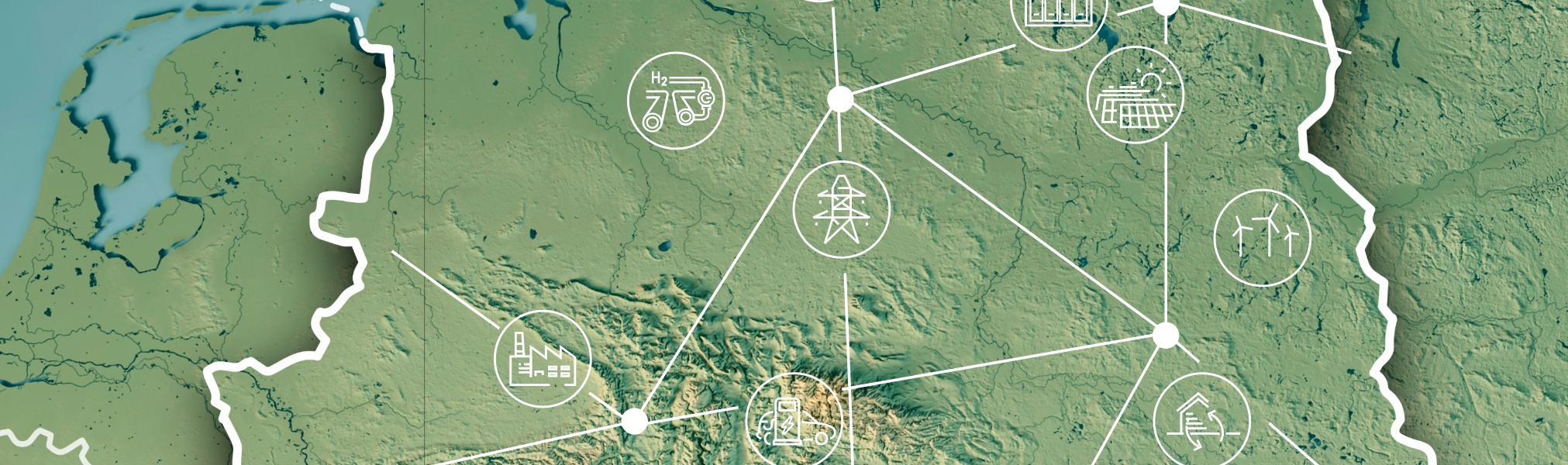


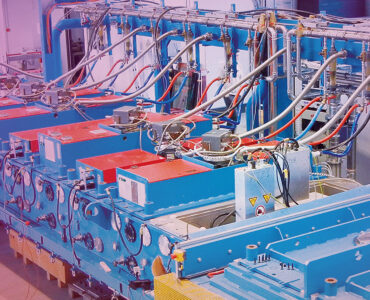






















Kommentieren